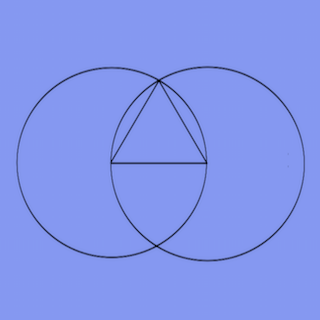Erst unter christlichem Einfluss wandelte sich die Bedeutung des Wortes »Dämon«, den die alten Griechen als »Daimonion« bezeichneten, zu etwas Bösem. Wer heute von einem Dämon spricht meint nicht etwa die neutrale, ja vielleicht eher sogar positive Ursprungsbedeutung dieses Begriffs – denn im Griechenland der Antike war das Daimonion nichts Böses.
Zu Zeiten Sokrates‘ war es eine geistige Schicksalsmacht, die einem Menschen als warnende oder ermahnende Stimme zusprach.
Mir aber ist dieses von meiner Kindheit an geschehen: eine Stimme nämlich, welche jedesmal, wenn sie sich hören lässt, mir von etwas abredet, was ich tun will, zugeredet aber hat sie mir nie.
– Sokrates über seinen Daimonion in Platons Apologie
Dieser Daimonion ist, man würde heute sagen, das »höhere Wesen« des Selbst. Sokrates empfand es als guten Geist, welcher ihn, wie obiges Zitat ja sagt, stets von Unrechtem abgehalten hatte. Er tauchte also immer dann auf, um ihm zu sagen was er nicht tun solle. In Form traumartiger Visionen teilte sich ihm sein Daimonion mit, nur für ihn hörbar, als innere Stimme. Sie war etwas Göttliches, einem Schutzengel gleichend, eine geistig-göttliche Personifizierung des eigenen Schicksals. Nie aber riet sie ihm zu etwas Gutem, sondern immer von etwas ab.
Es handelt sich beim Daimonion um eine innere, geistige Instanz, die uns ganz klar sagt, dass wir etwas tun sollen, oder aber nicht tun dürfen. In unserer Erfahrung wirkt dabei das Wissen um ein letztes Gutes: Das was man im Christentum als das »Gewissen« bezeichnet. Und als solches Gewissen meldete sich Sokrates‘ Daimonion, um ihn vor dem Wunsch seiner Freunde zu warnen. Sie nämlich redeten auf ihn ein, sich seinem Todesurteil durch Flucht zu entziehen. Das Daimonion aber warnte ihn dem zu widersprechen, damit er sich seinem nahenden Tode stellen.
Vom Erkennen und dem Entstehen des Selbst
Das Orakel von Delphi hatte verkündet, dass Sokrates der weiseste Mann von allen sei. Was er zudem, wie gesagt, als seinen Daimonion zu sich sprechen hörte, galt für manche als Beweis, dass Sokrates ein Heiliger ist. Sokrates aber wollte diese Orakelverkündigung nicht recht glauben und beschloss jemanden zu finden, der weiser war als er selbst:
Was meint doch wohl der Gott? Und was will er etwa andeuten? Denn das bin ich mir doch bewusst, dass ich weder viel noch wenig weise bin. Was meint er also mit der Behauptung, ich sei der Weiseste? Denn lügen wird er doch wohl nicht; das ist ihm ja nicht gestattet.
Und lange Zeit konnte ich nicht begreifen, was er meinte; endlich wendete ich mich gar ungern zur Untersuchung der Sache auf folgende Art: Ich ging zu einem von den für weise Gehaltenen, um dort, wenn irgendwo, das Orakel zu überführen und dem Spruch zu zeigen: »Dieser ist doch wohl weiser als ich, du aber hast auf mich ausgesagt.« Indem ich nun diesen beschaute – denn ihn mit Namen zu nennen ist nicht nötig; es war aber einer von den Staatsmännern, auf welchen schauend es mir folgendergestalt erging, ihr Athener: Im Gespräch mit ihm schien mir dieser Mann, zwar vielen andern Menschen auch, am meisten aber sich selbst sehr weise vorzukommen, es zu sein aber gar nicht. Darauf nun versuchte ich ihm zu zeigen, er glaubte zwar weise zu sein, wäre es aber nicht; wodurch ich dann ihm selbst verhasst ward und vielen der Anwesenden.
Indem ich also fortging, gedachte ich bei mir selbst: weiser als dieser Mann bin ich nun freilich. Denn es mag wohl eben keiner von uns beiden etwas Tüchtiges oder Sonderliches wissen; allein dieser doch meint zu wissen, da er nicht weiß, ich aber, wie ich eben nicht weiß, so meine ich es auch nicht. Ich scheine also um dieses wenige doch weiser zu sein als er, dass ich, was ich nicht weiß, auch nicht glaube zu wissen.
Hierauf ging ich dann zu einem andern von den für noch weiser als jener Geltenden, und es dünkte mich eben dasselbe, und ich wurde dadurch ihm selbst sowohl als vielen andern verhasst.
– Aus Platons Apologie
Sokrates kam nun zwar zu der Einsicht, dass er wusste weiser zu sein, als die mit denen er sprach. Doch das wusste er eben nur deshalb, da er es nicht wie jene, von sich selbst behauptete. Ebenso wenig verleitete andere zu solcher Vermutung. Er wusste dass er damit dem Orakelspruch zu Delphi gerecht geworden war, der ja lautet:
Erkenne dich selbst.
Dieses Selbst hatte Sokrates allerdings sehr viel ernster genommen, als jene, mit denen er sprach zur Beantwortung seiner Frage nach dem Weisesten. Für ihn entstand dieses Selbst erst durch die Selbsterkenntnis an sich, durch etwas, auf das man sich überhaupt einlassen muss.
Nur wer in sich reflektiert ist, bildet das, was man als Bewusstheit bezeichnen könnte. So meinte Sokrates mit seinem berühmten Ausspruch »zu wissen, dass er nicht wisse«, keineswegs dass er etwa unwissend gewesen wäre. Was er damit zu wissen glaubte, erklärte sich ihm aus einer Reflexion auf sein Wissen. Er stellte dabei fest, dass Wissen an sich, dass er und seine Gesprächspartner hatten, eher einem Vermuten glich, denn man glaubte dies und das zu wissen. Fragt einer jedoch einmal genauer nach und erkundigte sich über mögliche Beweise für dieses Wissen, sahen die Dinge doch gar nicht mehr so klar aus, wie man sie eben als Wahrheiten zu wissen glaubte. Hiervon ausgehend, gerät doch alles herkömmliche Wissen ins Schwanken.
Wie aber soll in solcher Ungewissheit noch das eigene Wissen sicher sein?
Wer weiß denn dann noch ob die eigenen Werte überhaupt richtig sind?
Sind wir uns denn alle nicht, auch heute noch, oft all zu sicher mit dem was wir wissen – über andere oder gar über uns selbst?
Aufgabe der Philosophie war darum immer, spätestens aber seit Sokrates, all das was man als selbstverständliches Wissen bezeichnet, immer wieder zu hinterfragen.