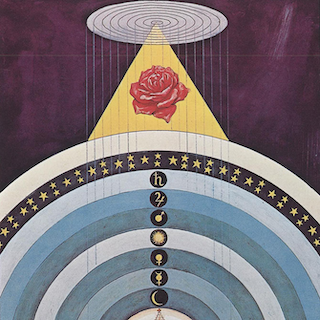Wer fragt nach Christlicher Mystik?
Wenn wir von Mystik sprechen, geht es da um eine besondere Form der Esoterik, eine geheime, innere Geistesdisziplin? Oder was vielleicht hat das Wort Mystik mit dem Mysteriösen zu tun? Eine Antwort auf beide Fragen…